Clemens Meyers neues Buch „Im Stein“ über die gesellschaftlichen Ränder in Prostitution und Zuhälterei hätte kürzer ausfallen können
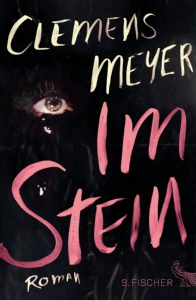
Der Spaß mit diesem Buch begann für mich schon, bevor ich es von der Klarsichthülle erlöst und den ersten Satz gelesen hatte. In der Zweig-Bibliothek bei mir um die Ecke war mir eine Frau aufgefallen; mollig und bunter Anorak, anbei zwei Kinder mit von Süßigkeiten verklebten Mündern. Die Mutti hatte DVDs in der Hand und eben ging es zum Comic-Regal. Hinterdrein noch ein Mitglied aus der vermutlich weiter verzweigten Familiensippe, so ein Onkel mit Baskenmütze und Brille, der offensichtlich in Sachen Literatur als Auskenner galt und so durfte ich folgenden Dialog hören:
Mutti: Du, ich hätte gerne das Buch hier, von dem aus dem Osten.
Onkel: Du meinst Der Friede im Osten, von dem, der jetzt gestorben ist?
Mutti: Nee, ich meine doch hier aus dem Osten.
Onkel: Du, da sind noch viele aus dem Osten, die schreiben.
Mutti: Ich meine doch hier, den Jungen aus dem Leipziger Osten, hier aus Reudnitz.
Clemens Meyers neues Buch Im Stein wünschten sie also und die freundliche Bibliothekarin verwies auf eine lange Warteliste. Immerhin, 23,70 Euro kostete aktuell das neue Buch und es wird manch einer bedenken, dass er doch erst mal neue Schuhe oder was auch immer kaufen muss.
Magda aus Cottbus und Lilli aus Jena schwärmen für Schuhe, freilich in einer Preislage, dass man sich Meyers neues Buch einundzwanzigmal davon kaufen könnte. Wie aktuell Im Stein im oberen Segment des Buchhandels, so rangieren deren schwarze hochhackige von Versace ganz oben. Zitat: „Mit der goldenen Lasche um die Spitze.“ Das soll sicher keine Schleichwerbung sein, aber wo Marke und Design zum nahezu therapeutischen Ersatz, zum psychogenen Stimmungsaufheller werden, kann es nicht einfach heißen: schicke Schuhe.
Clemens Meyer ist zweifelsohne Auskenner in Sachen Peep-Toe-Pumps, Szene und Milieu, aber es hieße das Buch oberflächlich zu interpretieren, würde man annehmen, es wäre allein von Belang, dass man hier wie ein Spion den Frauen, die bei Erscheinen des Gastes die Adidasjacke abstreifen und sich in ihren Dessous präsentieren, zuschauen kann. Meyer geht weiter, wir können auch noch Gedanken hören und lesen, das lässt in guter Weise an eine Nachfolge von Maxie Wanders Guten Morgen, du Schöne denken.
Das Buch beginnt mit solch einem Protokoll und Minimal-Art, dürre Sätze teilweise. Es spricht eine Frau, die ihre sprachlichen Fähigkeiten offensichtlich nicht gerade übermäßig ausgebildet hat, aber für ihre Selbstbetrachtungen und Lebenserinnerungen gewinnt diese spröde Kargheit einen besonderen Reiz. Sie wartet auf Kunden, die lieber Gäste genannt werden sollten, sie denkt an ihre Kollegin, freut sich auf Zuhause, wünscht sich für später ein Kind, das vielleicht wie ihre Freundin Sabine heißen könnte.
Sie erinnert sie sich an Märchen und Gedichte aus ihrer Kindheit, an den Fischer und seine Fruu, von der Mutter vorgelesen, an diesen anderen Dialekt von den Großeltern aus Bad Doberan. Bald bekommt sie einen Anruf, denn das blinkende Handy und die potentiellen Nachfragen über Anfahrtsweg, Preise und Details der Dienstleistung sind ständige Praxis in diesem Job. Ein Hausbesuch wird gewünscht, da checkt sie Adresse und Telefonnummer, meldet sich ab und schon fahren Leser oder Leserin mit ihr im Taxi zum Hotel und weiter in die Stadt und das große Areal dieser Texte hinein. Spätestens im Taxi wird unüberhörbar, hier kommt die Musik nicht nur aus dem Autoradio. Tack, tack, Ein-Wort-Sätze und dann wieder ein etwas längerer, ob in der Sprache der Liebesarbeiterin oder den Erinnerungen des ehemaligen Jockeys, da tickt Metrum. Hier berichtet und dichtet ein Rhapsode, da hörst du den dunklen Reiter, genau auf dem Wall zwischen Roman und epischer Versdichtung. Die metrische Etappe endet, als Arnie Kraushaar, auch genannt AK47 von einer Kugel hinterrücks zu Boden geht, der Ohnmacht nahe fabuliert er, wiederholt sich und streift ins Surreale.
Arnie, so lesen wir dann, versuchte alles über das Management und Betriebswirtschaft zu erfahren und hatte nach der Wende – den BMW parkte er abseits – kurz an der Hochschule bei einem Professor aus dem Westen studiert. Über Wäscherei und Immobilien dachte er genauso akkurat nach wie über Kapitalakkumulation und Börse. Auf tausend Einwohner kommen statistisch eine Prostituierte und ein Taxi, meinte er zu wissen. Er wollte nur alles richtig machen, denn der Kuchen war groß und andererseits kann nicht mitverdienen, wer tot ist, so wird hier die Firmenphilosphie der Branche karikiert.
Spannend kann es schon werden bei der Lektüre dieses Buches. Spätestens seit den Leichen im Moor erzählt der Autor im konventionellen Stil, erinnert etwas an einen ins Deutsche übersetzten englischen Kriminalroman, dann wieder abrupter Bruch: Eckie Edekirsch (Anspielung auf einen klebrigen Fruchtlikör und die Wortschöpfung aus unserer mitteldeutschen Gegend, in der Mann Kirsche oder Körsche für junges Mädchen sagt) eben dieser Eckie moderiert eine Rundfunksendung um Geschlechtsverkehr und Befriedigung in schlüpfrigen bis unappetitlichen Worten, wobei dann doch alles altbacken wirkt. Ein im Dienst gealterter Kommissar, von seiner Lieblingshure regelmäßig mit „mein Kuutster“ begrüßt, findet so ein Wort wie Bumsen herrlich altmodisch. Nicht jeder wird so urteilen, zweifelsohne dürfte bei solcherlei Sexismen – wenn es beispielsweise darum geht, ob sie es ohne Gummi macht oder vor dem Abspritzen KB, also Körperbesamung, vereinbart wird – eine gewisse Schicht der bigotten Leserschaft pikiert sein – aber für diese wurde das Buch wohl auch eher nicht geschrieben.
Wo es nun hingeht mit Clemens Meyers Roman, den ich hier nicht vollständig nacherzählen will, soll doch die Spannung nicht demontiert sein, muss Leserin und Leser selber mitfahren und erfahren, was der Graf aus Bielefeld an der polnischen Grenze für Fledermäuse sieht oder ob man sich in einen Ladyboy verlieben kann.
Viel verunsichernder als das Passieren der moralischen Grenzen des recht und billig und verstaubt denkenden Bürgers, wird für mich während des Lesens, dass die literar-ästhetische Grenze überschritten oder zumindest strapaziert wird, weil die stilistische Einstellung ständig hin und her springt.
Der Roman ist rasant, ändert die Einstellungen und erhöht die Geschwindigkeit schneller als im Spielfilm. Zu schnell, denke ich, wird hier erzählt und leider oft nur berichtet. Der wirklich fleißige Autor hat, wie nur all zu verständlich, längere Pausen eingelegt zwischen der Arbeit mit den Audio-Dateien der Interviews, den Erzählungen neuerer Leipziger Stadtgeschichte, gut recherchierter Kriminalfälle und in Szene gesetzter Lebensberichte; es sind Pausen, die sich auf den Schreibstil auswirkten und wirklich nicht unbemerkt bleiben.
Dabei ist es schon rührend, wenn einige der leider oft nur flüchtig angedeuteten Figuren literarische Ambitionen haben, sich an Märchen oder Sagen erinnern. Hier klingt wohl an, was der Autor beim Schreiben seiner schnellen und modernen Texte vermutlich selber empfunden hat, das Fehlen stiller Plätze des Verweilens, des Innehaltens in Leben und Text oder eines liedhaften Tons, der wie in Der Mond ist aufgegangen noch aushalten kann.
Ein gut erzählter Roman, zumal über 548 Seiten, bräuchte Ventile und Ruhepunkte, in denen nur die Landschaft leuchtet oder, um es überspitzt zu formulieren, umständlich die Pfeife gestopft und der Lehnsessel herangerückt wird und vor allem bräuchte es klar entworfener handelnder Personen, die sich während der Erzählung entwickeln und nicht nur beliebig eingeführt und dann wieder fallen gelassen werden.
Von Ereignissen und Stilbrüchen werden Leserin und Leser wie gehetzt und die Überfülle langweilt irgendwann dann ähnlich wie die zu überladen aufgetafelten Speisen einer Familienfeier in den Nachkriegsjahren, so nach dem Motto: Darf es noch ein Erzählspeck, noch eine trübe Suppe aus dem Milieu sein, noch eine Beilage aus Interview-Gemüse? Ab der Hälfte des Buches überkommt einen da doch möglicherweise eine gewisse Verstimmung, es beginnt zu ermüden.
Um hier nicht missverstanden zu werden, ich mag Clemens Meyer, weil er Wirklichkeiten erzählen kann und das mit innerer Anteilnahme, um nicht zu sagen mit Herzblut. Niemals war soviel Leipzig und ein so irrer Sound von kleiner Großstadt wie hier. Er beschreibt schon seit Als wir träumten den Ist-Zustand der Welt mit dem Blick eines Eroberers, der Neuland sichtet. „Als Kind warst du immer der Gangster, der Indianer, der Seeräuber …“, lässt er Arnie über sich selbst sagen.
Auch wenn im modernen Roman alles sehr lose Collage sein darf und Einschübe von Berichten und Interviews und Schlagzeilen seit John Dos Passos nichts Neues sind, hier geht es bei unterbrochener Handlung und wechselnden Stilen nicht unbedingt um Kunstgriffe und Paradigmenwechsel im modernen Roman. Was wir da in Händen halten, ist eher ein Konvolut; nicht die goldene Lasche des hochhackigen wie hochpreisigen Schuhs symbolisiert Formvollendung, sondern der Bindfanden ist um den Packen drum gezurrt und es fallen Blätter mit Interview, Notizen bis hin zur betriebswirtschaftlichen Recherche heraus und immer wieder verschiedenste Erzählansätze.
Nun haben Rotlicht-Betrieb und ein ernst zu nehmender Verlag gemeinsam, dass die Kasse stimmen muss. Wer was liefern will, gerade im deutschsprachigen Raum, muss einen Roman abgeben und das Buch scheint dafür ja auch dickleibig genug. Noch die Typographie des Titelblatts erinnert absichtlich an die Bestseller der alten Bundesrepublik, die Blechtrommel hatte ähnliche Schriftgestaltung und genauso ein Obelisk von Literatur-Ereignis wäre erwünscht gewesen. Dabei wäre mir eine andere, weniger eingängige Variante für die, die noch lesen, bekömmlicher erschienen: Aus dieser hohen Fleißarbeit hätten sich etwa sieben bis zehn Erzählungen gestalten lassen, die ein leichtes, aber nicht zu leichtes Büchlein gefüllt hätten. Das Kabarett-Programm von Eckies Edelkirsche gleich auf Hör-CD und außerdem wäre sicher auch ein Krimi denkbar gewesen, vielleicht sogar ein Insel-Bändchen mit poetischen Sequenzen vom Hängenbleiben in der Lipsiusschleife und anderen poetischen Momenten des Buches.
Sicher nicht sehr gewinn-orientiert und praxisnah von mir gedacht: Drei bis vier kleine Bändchen, alles nochmal kritisch durchgesehen und nicht ohne Streichungen, das wäre es gewesen – statt des Steins vier kleine Bändchen, wenn, dann vielleicht im Schuber vereint.
Aber die Zeiten sind nicht so, der Hardcover wiegt mehr als ein Pfund und damit ist dieses Buch aus dem prallen Leben nebenbei erwähnt zu unhandlich, um für unterwegs mal eben eingesteckt zu werden. Vielleicht nimmt man sich da die beigegebene Postkarte heraus.
Vorn sehen wir Clemens Meyer inklusive Designerbrille, die Tätowierung guckt auch vor, auf der Rückseite das barocke Eingangsportal des altehrwürdigen Fischer-Verlages. Nur muss sich gerade diese nahezu sakrosankte Institution schon die Gretchenfrage gefallen lassen: Wie hältst du es mit dem Lektorat?
Clemens Meyer: Im Stein
S. Fischer
Frankfurt/Main 2013
557 S. – 22,99 Euro



Geht das hier auch schon los? Bei der Amazon-Seite von „Im Stein“ treibt sich auch so ein Troll rum, der jeden anpöbelt, der es wagt, Kritik an dem Werk zu äußern – mittlerweile wird da schon gemutmasst, dass es der Autor selbst ist, der da unter Pseudonym seine Kritiker runtermacht. Nachdem ich mich gerade durch diesen (stilistisch und „argumentativ“ auffallend ähnlichen) Shitstorm gescrollt habe, bin ich langsam geneigt, dem Glauben zu schenken.