Büchersonntag, Folge 19: Jan Faktor schreibt mit seinem neuen Roman die tschechische Erzähltradition fort
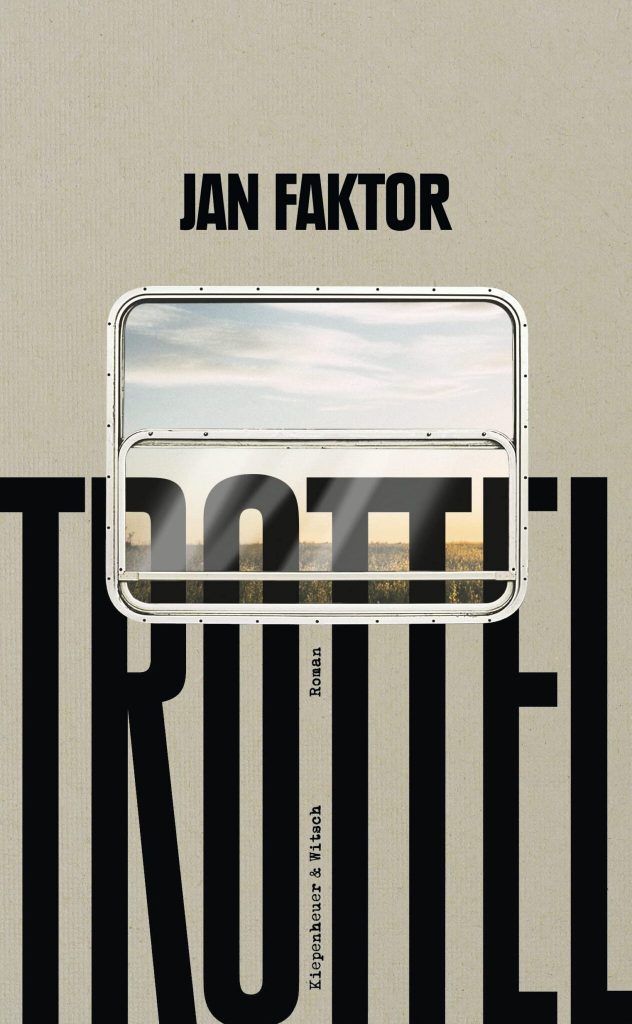
Ein Trottel ist ein Mensch, der einfältig ist. Er ist – zumindest nach außen hin – naiv und mit der Welt zufrieden, stets gut gelaunt. Wie es aber in seinem Inneren aussieht, ist nicht gewiss. Vielleicht ist er abgestumpft, resigniert oder durchtrieben; vielleicht ist er aber auch feinsinnig und tieftraurig, so traurig, dass keine Träne ihn erleichtern und kein Wort ihn trösten können. So oder so ähnlich muss es Jan Faktor gegangen sein, als sein Sohn mit nur 33 Jahren 2012 gestorben ist. Er nahm sich das Leben, weil sein Kopf eben dieses nicht mehr aushielt. Nun hat ein Sonderling über den anderen ein Buch geschrieben. Und so bleibt die besondere Geschichte von Vater und Sohn für immer in der Welt. Jan Faktor wurde für seinen Roman Der Trottel für den Deutschen Buchpreis nominiert und erhielt dann den Wilhelm-Raabe-Preis dafür. Offenbar sind Literatur-Kenner manchmal auch Seelen-Versteher.
Man kann den Roman als zwei Bücher in einem verstehen, wie Katharina Granzin in der „Frankfurter Rundschau“ richtig erkannte. Der Roman im Roman erzählt vom Verlust des eigenen Sohnes. Es ist ein Trauma, das der Autor ohne narrative Ummantelung durch den zweiten Roman literarisch nicht verarbeiten hätte können. Der Leser kann schmerzlich erahnen, wie schwer es sein muss, unter diesen Umständen überhaupt noch weiterzumachen. So gerät der Rahmenroman, eine Art Autobiographie Jan Faktors, auch zuweilen ins Stocken. Immer wieder werden Gedanken an den Sohn und an frühere Erlebnisse ins Bewusstsein gespült. Dies geschieht dann wortspielerisch, plätschernd, reich an Details und Anekdötchen, Flunkereien und Narreteien. Die eigentliche Autobiographie präsentiert sich dagegen eher wie eine nüchterne Beschreibung der äußeren Umstände, mit denen man gar nichts zu tun hat, weil sie einfach passieren.
Das Kaputte als Markenzeichen des Sozialismus
Offenbar war das Kaputte symptomatisch für den Sozialismus. Nach der Lektüre des Buches hat man jedenfalls diesen Eindruck. Denn die Geschichte des Trottels, der zugleich der Autor Jan Faktor ist, beginnt in Prag nach dem sowjetischen Einmarsch. Hier beginnt der Ich-Erzähler mit einem Informatik- bzw. EDV-Studium, hält aber nicht lange durch. Er arbeitet dann in einem „Büro für Lügenstatistiken“ als Programmierer. Dann fährt er Armeebrötchen aus. Und er macht erste Liebeserfahrungen, unter anderem mit einer „Teutonenhorde“, also einer Gruppe junger DDR-Bürger, zu der auch seine spätere Frau gehört.
Schließlich ist es offenbar für ihn in der Tschechoslowakei nicht mehr auszuhalten. Er „emigriert“ aus der „Vorhölle Prag“ nach Ostberlin/Prenzlauer Berg und gerät – wahrscheinlich auch über seine Frau, die eine der Töchter der berühmten DDR-Schriftstellerin Christa Wolf ist – in eine politische Undergroundszene. En passant erfährt die Leserin durch den tschechischen Blick auf die DDR einiges über die fremde Wahrnehmung auf ihr Land. So wundert Faktor sich über die ideologisch morphisierte DDR und entdeckt später die Band Rammstein, die wiederholt im Roman als eine Art Autorität zur Sprache kommt. Noch spannender aber ist der Blick in die Kindheit und Jugend Faktors im nebulösen Prag. Dagegen wirkt die DDR – politisch wie alltäglich – beinahe wie ein fröhliches Ländchen.
Faktor schmeckt und riecht den 60er, 70er und 80er Jahren in Prag und Berlin nach. Damit entsteht ein lebendiges Assoziationsbild. Aber es ist eben kein detailreicher Blick auf die Prenzlauer-Berg-Boheme, wie Katharina Teutsch in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ schreibt, sondern das Einfangen einer Atmosphäre, die eigene Erinnerungen evoziert und mit denen den Trottels abgleicht. Natürlich sieht er den Mangel überall, das Abwirtschaften, gleichzeitig fühlt er sich sicherer als in seiner Heimat und durch die Freizügigkeit am FKK auch selbst gleich viel freier. Seine Mitarbeit am Rundbrief des „Neuen Forum“ 1989 und seine Mitarbeit bei der Zeitung „Die Andere“ wird nur am Rande kurz erwähnt und spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Sinn und Form
Mosaiksteinartig fertigt Faktor seinen Roman aus Erinnerungssplittern zusammen, dabei dreht er jeden Stein dreimal in der Hand und schweift ab in Geschichten und Erlebnisse von früher. Die Abschweifung wird zum ästhetischen Prinzip erhoben. Und wie das bei der Erinnerung an liebgewordene Menschen ist, merkt man, wie Faktor oft schmunzelt über lustige Begebenheiten und weint über das Schicksal, das ihm den Sohn entrissen hat. Gleichzeitig schwingt die tschechische Sprachmelodie durch den Raum, die ihren ganz eigenen Sprachwitz erzeugt, wenn Faktor aus seinem Buch selbst vorliest, abgesehen von allem Wortwitz, den der Autor auch sonst noch so einstreut: etwa, wenn er seinem Hang zum ganz genauen Beschreiben technischer Details nachgibt oder wenn er sich über etymologische Besonderheiten der deutschen Sprache wortreich wundert.
Eine weitere Besonderheit des Buches von Faktor ist auch, dass es den Anschein erweckt, als sei dieser Roman noch nicht fertig geschrieben und werde es auch nie sein. Kein Wort darf verändert werden, lässt uns der Autor hier und da in einer Fußnote, die nicht gelöscht werden darf, wissen. Selbst Rezensenten werden Schlagzeilen vorgeschlagen, so als hätte der Autor Angst, dass jemand seine Erinnerungen zensieren oder begradigen wolle. Überhaupt soll nichts verändert werden am Niedergeschriebenen. Alles soll so stehen bleiben, wie es aus Faktor herausfließt, nichts soll die Geschichten verfremden, verschönern, verknappen oder verpointieren. Die Erinnerung soll unverfälscht bleiben und kein Lektor soll es wagen, dieses Heiligste anzutasten. Dass das literarisch tatsächlich funktioniert, mag angezweifelt werden können, als Stilmittel sei es allemal für diesen Roman gestattet.
Die tschechische Erzähltradition
So wie Jaroslav Hašeks in seinem Braven Soldat Swejk oder Bohumil Hrabal in Tanzstunden für Erwachsene und Fortgeschrittene folgt auch Faktor einem eigentümlich mäandernden Erzählrhythmus, man könnte ihn den „tschechischen Erzählmodus“ nennen: Da springen und vermischen sich die Sprachebenen: Neben Ironie und Selbstironie gesellt sich eine detailverliebte sachliche Beschreibungsebene. Die starke Autofiktionalität bricht zugleich wieder die Sachebene auf, weil man nie sicher sein kann, was erfunden und was real ist – so wie das nun mal mit Erinnerungen oft so ist. Das nicht genug, zieht Faktor mit Zitierungen, Sentenzen, Lautakrobatik und Fußnotenkommentaren weitere literarische Register. Oft scheint Faktor die Wirklichkeit anarchisch zu unterlaufen, verschwimmt einiges zu einem Schleier, hinter dem die wirkliche Wirklichkeit verborgen liegt.
Im Verlaufe seines Textes wird einem aber gleichzeitig vor Augen geführt, dass diese Art von grenzgängerisch-kreativem Sein einen sehr schmalen Grat beschreibt, der bei dem einen zur Literatur, bei dem anderen zum Tode führen kann. Denn wo der Trottel Witz und Leichtigkeit aus den Verhältnissen herausliest, verliert der Sohn den Boden unter den Füßen. Beide verlieren sich zuweilen in Einzelheiten, vergessen sich selbst und gehen im Detail auf. Doch während der eine an Qualität gewinnt, geht dem anderen seine eigene verloren. Die Ablenkung im Text erscheint als Flucht und erhebt sich zur Methode. Denn wo das Herz den Schmerz nicht mehr (in Worte) fassen kann, da weicht es (wortreich) aus.
Der Trost von Literatur
Faktors Roman ist voller widersprüchlicher Gefühle. So ist das Buch zwar seiner Frau gewidmet, lesen soll sie es aber besser nicht. Zwar war seine jüdische Familie auch den Gräueltaten des NS-Regimes ausgesetzt, aber zu Hause sind die Juden vor allem Gegenstand von Witzen. Und obwohl es bei Faktors wohl auch ordentliche Auseinandersetzungen geben mag, ist das Buch eine einzige Liebeserklärung an seine Frau und an seinen Sohn. Faktors zersetzender Humor lässt einen – so man ihn selbst besitzt oder zumindest versteht – eine ganze Menge Lebensschmerz verkraften. Das Buch ist ein Versuch, das Unsagbare dieses Schmerzes wenn nicht sagbar, dann doch umschreibbar und zeigbar zu machen.
Faktors Trottel folgt damit eindeutig der Kategorie des Schelmenromans, wobei das Wort Schelm im Deutschen zu lustige Konnotationen erweckt: Der Sonderling schlägt sich durchs Leben, stammt aus einer unteren Schicht, scheint ungebildet zu sein, ist aber bauernschlau und sucht nach Aufstiegsmöglichkeiten. Er durchläuft dabei unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und wird zu deren Spiegel. Allerdings hat der Trottel Jan Faktor – wie der echte Picaro („picaro“, spanisch für „Schelm“) – keinen Einfluss auf die Geschehnisse um ihn herum, kann sich aber meist aus brenzligen Situationen retten. Genau wie die großen Autoren von Schelmenromanen – wie Grimmelshausens Simplicissimus, Thomas Manns Krull oder Hašeks Soldat Schweijk – greift auch Faktor auf das Mittel der fingierten Autobiographie mit satirisch-ironischen Zügen zurück, um die Absurdität bestimmter gesellschaftlicher Missstände zu kritisieren.
Am Ende jeder Trottel-Geschichte steht der Tod: entweder im geregelten Trott des Lebens oder als Flucht aus der realen Welt. Einzig in Geschichten, Erzählungen, also in der Literatur, scheint es – so die Quintessenz – lebendig zuzugehen. In ihnen fühlt sich der Trottel zu Hause. Auch wenn das Leben des Trottels mit dem Ende konfrontiert wird, er den Schmerz der Welt in sich aufnimmt, zerbricht er nicht daran. Denn die Geschichten eines Schelms sind unendlich. Und mit ein bisschen Fantasie können sie immer weiter forterzählt werden …
Jan Faktor: Der Trottel
Verlag Kiepenheuer & Witsch 2022
400 Seiten



Kommentar hinterlassen