Büchersonntag, Folge 17: Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert blickt in „Vom Aufstehen“ mit nüchternem Blick auf ihr Leben zurück, das von einer traumatisierten Mutter geprägt war
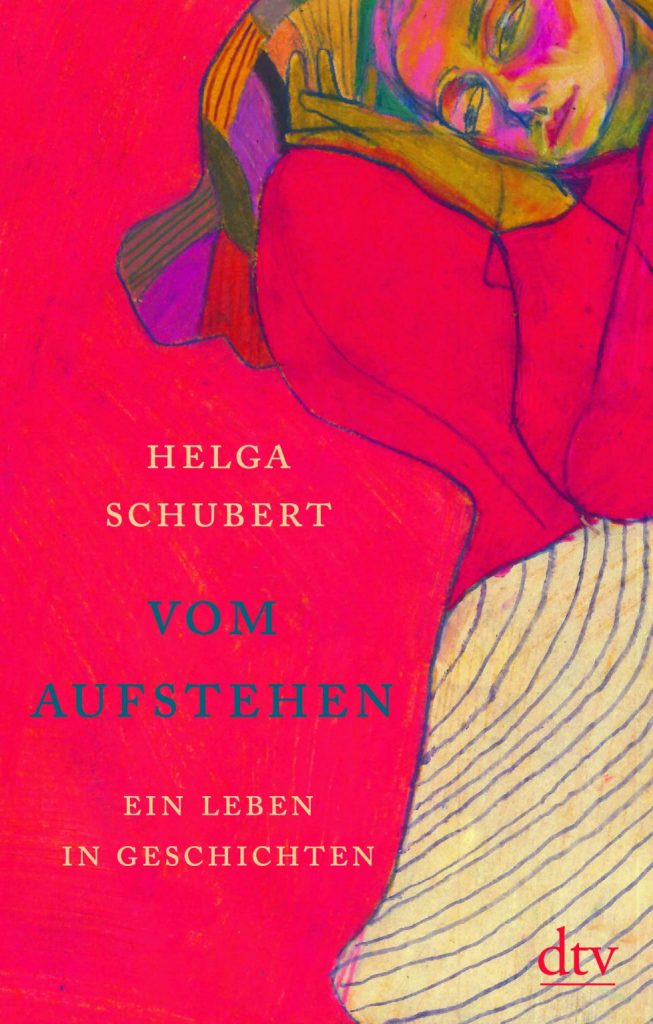
Manchmal braucht es Abstand zu Dingen, um über sie schreiben zu können. Das trifft auf historische Ereignisse genauso zu wie auf die eigene Lebensgeschichte. So mag es auch Helga Schubert ergangen sein, als sie sagte, dass sie erst 80 werden musste, um das Buch Vom Aufstehen zu verfassen. Für diesen Text bekam sie 2021 den Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Der Preis wird alljährlich in Klagenfurt verliehen. Dahin durfte sie als junge Schreibende in der DDR nicht hinreisen. Am Ende ihres Lebens schließt sich aber ein Kreis, denn jetzt ist sie nicht nur Teilnehmerin an einer Preisvergabe, sondern selbst die verdient Honorierte.
Vom Aufstehen ist ein verstörendes Buch – nicht nur wegen des dokumentarischen Stils, den die Autorin wählt. In nüchternen Worten erstattet Schubert Bericht über ihr Leben. Und nüchtern verlief ihr Leben auch, zumindest, wenn man es durch die Brille ihrer Mutter betrachtet, die wenig Nähe in ihrem Leben zuließ. An dieser Kälte verzweifelt die Autorin, hinterfragt sie, hält ihre emotionale Betroffenheit mit ihrem sachlichen Bericht im Zaum, weil
sie anders nicht auszuhalten sind.
Heldentaten und andere Unterlassungen
Schon am Anfang ihres Buches schockt die Autorin ihre Leser: Drei Heldentaten habe sie in ihrem Leben vollbracht, erklärt Helgas Mutter ihrer Tochter, als diese gerade ihr erstes Kind auf dem Arm hält: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie im Zweiten Weltkrieg auf die Flucht mitgenommen und sie nicht vor dem Einmarsch der Russen umgebracht. Diese drei Heldentaten und andere Unterlassungen sollen Heldentaten sein, fragt man sich, wenn man diese Ungeheuerlichkeiten liest. Und es kommt noch schlimmer: Die Mutter verletzt die Tochter immer wieder: entweder mit Worten oder mit Liebesentzug. Einmal sagt sie zu ihr: „Wenn du doch damals nach der Flucht gestorben wärst“. Und ein anderes Mal: „Die Menschen deiner Generation sollten ihren Müttern, die sie damals auf der Flucht retteten, ein Denkmal setzen.“
Mit diesem Buch tut dies Helga Schubert, allerdings anders als erwartet. Die Flucht ist das Lebensthema der Mutter, die mit der kleinen Helga zu Fuß vor den Panzern der Roten Armee zu den Schwiegereltern nach Greifswald flieht. Dort wird die Fünfjährige todkrank: Erst Fieber, dann Scharlach, Ruhr und schließlich eine Mittelohrentzündung, die operiert werden muss. Die Mutter setzt sich mit der Pistole ans Bett des Kindes und sagt zu
ihr: „Wenn du jetzt stirbst, erschieße ich mich.“ Doch Helga wird wieder gesund. Die Mutter wirft die Pistole ihres Schwiegervaters in den Fluss. Und sie vergiftet auch nicht ihre Tochter, als die Russen kommen. Beide überleben. Die Mutter wird über 100 Jahre. Aber erst nach ihrem Tod kann Helga Schubert das Buch über sie schreiben, das sie ihr versprochen hat.
Helga Schuberts Ich-Erzählerin
Helga Schubert wird – anders als die Ich-Erzählerin – 1940 in Berlin geboren. Ein Trauma ihres Lebens ist der Verlust des Vaters, den sie nie kennen lernte. Als er an der Ostfront von einer Granate zerfetzt wurde, war Helga erst ein Jahr alt. Ihr Vater war 28 Jahre. Sie vermisst ihn umso mehr, als ihr Mutter unterkühlt, lieblos und hart mit ihr umgeht, sie nie in den Arm nimmt. Sie kann das Buch erst schreiben, als die Mutter nun gestorben ist. Insofern ist das Buch auch ein Resümee ihres Lebens, ein Buch erstarrten Verständnisses für heute unvorstellbare Zustände und des nachsichtigen Verständnisses für sich selbst und ihre Mutter.
Mit der Ich-Erzählerin teilt Helga Schubert nicht nur den Namen, sondern auch das Trauma einer selbst vom Krieg, der Zeit und den Mitmenschen traumatisierten Mutter, deren Lebenswünsche mit dem Kind Helga nicht in Erfüllung gehen. Deren Heldentat besteht darin, sich in einer grauenhaften Welt, in der sie auf der Flucht von den Verwandten zurückgelassen wird, vom Schwiegervater zur Kindsmörderin angestiftet wird, und in der sie sich trotz schlechter Zukunftsaussichten, Krieg und ohne Mann sich für das Kind in ihr und bei ihr entschieden hat und damit Menschlichkeit bewahrt hat.
Spuren der transgenerationalen Psychotraumata
Auch an Helga Schubert ist etwas von dieser Unnahbarkeit und Unterkühltheit der Kriegsgeneration hängen geblieben. Das zeigt sich sowohl in ihrem literarischen Berichtsstil als auch im Hinterfragen dessen, wie die Mutter geworden sein konnte, wie sie war. Dieses sachliche Hinterfragen kommt nicht von ungefähr, war Schubert doch lange als Psychologin und Therapeutin in der DDR tätig. Und so ist das eigene Befragen keine Nabelschau oder
narzisstische Selbstbespiegelung, sondern sowohl psychologisch als auch literarisch ein schwieriges Unterfangen, da für eine solche intime Beobachtung für die Psychologin meist der Abstand zu sich selbst fehlt, und für die Literatin die bewertende Innenschau emotional in Zaum zu halten ist. Es ist daher ein wahres Kunststück, beides zugleich in Waage zu halten.
Auch über das Leben in der DDR reflektiert die Ich-Erzählerin klug und ohne falsches Pathos. Sie inszeniert sich nicht als Regimekritikerin, beschreibt aber, wie ihre Karriere als Schriftstellerin behindert wurde. Weder durfte sie 1980 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilnehmen noch einige Jahre später den Hans-Fallada-Preis annehmen oder zu einer gemeinsamen Lesung mit Herta Müller in den Westen reisen. Beharrlich geht sie jedoch ihren
schriftstellerischen Weg weiter.
Sine ira et studio
Ohne Zorn und Eifer, aber auch ohne Groll und in ungekünstelter Sprache gelingt es Helga Schubert, ihre Lebensgeschichte und die ihrer Mutter literarisch zu verarbeiten. Ob dies mit „christlicher Vergebung“ zu tun haben mag, wie Theresa Hübner vom SWR2 behauptete, ist meines Erachtens dafür unerheblich. Viel wichtiger ist, dass der Leser trotz oder gerade wegen Schuberts Sachlichkeit selbst eine Innerlichkeit entwickeln kann, die einen Bezug zu den Figuren aufbaut. Sie lässt damit eine unvoreingenommene Bezugnahme entstehen, die nicht vorverurteilend, parteinehmend oder irgendwie wertend das Geschriebene mit einer ideologischen Grundierung überzieht. Ihre literarischen Mittel sind sparsam, aber anschaulich:
Da liegt das Lavendelsäckchen neben dem Kopfkissen, wird der an die Tochter verschenkte Ring der Großmutter einfach an die Urenkelin vererbt oder kuschelt sich Helga morgens noch mal unter die Decke und wartet auf den Duft des frisch aufgebrühten Kaffees ihres Mannes.
Schuberts Buch ist nicht einfach ein Buch über Verletzung und Heilung oder eine von vielen Flüchtlingsgeschichten des Zweiten Weltkrieges. Es ist ein Buch, das eben nichts heilen will. Es ist kein Pflaster für geschundene Seelen. Es schließt weder Augen noch Wunden, sondern zeigt Narben auf Körper und Seele. Mit diesen Narben müssen Menschen leben lernen. Es ist und wird eben nicht „alles gut“. Durch Schuberts Buch bekommen diese Kennzeichnungen aber einen metaphysischen Sinn: Sie werden nicht vergessen. Gerade weil die eigene Generation die Probleme der vorhergegangenen aufarbeiten muss, wenn sie nicht zerbrechen will, so kann man sich – wie Schubert es in ihrem eigenen Leben offenbar gelungen ist – Menschen, Orte und Momente der Geborgenheit suchen: Kraftorte. Ein Buch, das aktueller nicht sein kann.
Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten
dtv Verlag
224 Seiten



Kommentar hinterlassen